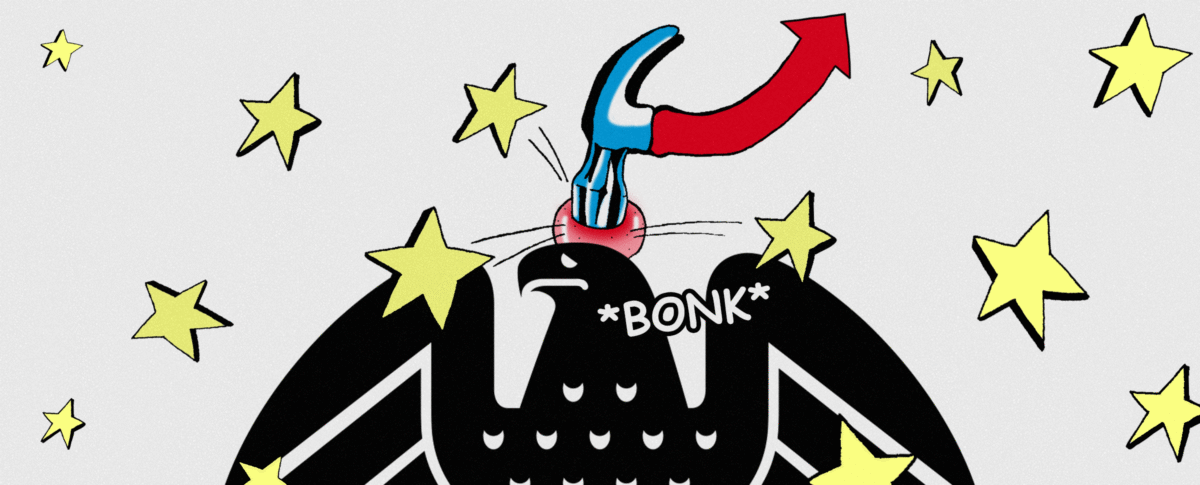Von Sandeep Preinfalk // Illustration von Luca Butt
Die Alternative für Deutschland (AfD) bleibt für die deutsche Politik eine der größten Herausforderungen. So konnte die Partei in der letzten Bundestagswahl sowie in den Landtagswahlen in NRW massive Stimmengewinne erzielen und erreicht in diversen Umfragen immer wieder Spitzenwerte. Doch wie geht man mit dieser scheinbar unaufhaltsamen Bedrohung richtig um?
Zuallererst ist es wichtig, zu verstehen, warum die AfD eine Gefahr und keine demokratische Alternative darstellt. Die AfD ist eine rechtspopulistische Partei. Das bedeutet, dass sie sich als einzig wahre Volksvertretung ansieht, Eliten und politische Gegner als illegitim betrachtet und das Volk als homogene Masse mit einem einheitlichen Willen begreift. Solche Züge sind daran erkennbar, dass die Partei sich in ihrem Wahlprogramm deutlich häufiger als andere Parteien auf das Volk und die Eliten bezieht. Außerdem polarisiert sie bewusst und greift gezielt die Eliten an, um sich von ihnen abzugrenzen. Da die AfD eine rechte Ideologie vertritt (ersichtlich etwa an der Ablehnung des Multikulturalismus oder Assimilationsforderungen an Migrant:innen), definiert sie das Volk über die Nation. Dies geschieht durch ethnokulturelle Merkmale, sodass Ausländer:innen und andere „Fremdgruppen“ zu Nichtmitgliedern der Gesellschaft deklariert werden.
Es ist in der Forschung kaum umstritten, dass solche rechtspopulistischen Parteien demokratiegefährdend sind. In einem Artikel einer vergangenen Heuler-Ausgabe (# Heft 136/Die AfD – Eine Gefahr für die Demokratie) wurde dieses Problem ausführlich dargelegt (weitere Literatur diesbezüglich wird unten aufgeführt).
Das demokratische Gefährdungspotential der AfD könnte noch weiter gespannt werden, indem man ihre rechtsextremistischen Aussagen und die Urteile des Verfassungsschutzes berücksichtigt. Die AfD ist also mehr als nur eine laute Partei, die unangenehme Wahrheiten ausspricht und einem vermeintlichen linken Mainstream widerspricht.
Doch das zu erkennen und zu begreifen, ist nicht einfach. Es erfordert politisches Wissen und die Bereitschaft, sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen. Etwas, was AfD-Wähler:innen eher weniger aufweisen. Wie schafft man es dennoch, wenigstens einen Teil davon zu überzeugen?
Zunächst müssen wir uns darüber einig werden, dass nicht die gesamte AfD-Wählerschaft verloren ist. Zum einen ist nicht jeder von ihnen überzeugter Rechtsextremist. Ein Teil von ihnen spiegelt die Unzufriedenheit in unserem Land wider. Zum anderen können wir es uns nicht leisten, so viele Menschen aufzugeben.
Aus dieser Einsicht ergeben sich Folgen für die Politik, Gesellschaft und Medien. Politische Entscheidungsträger:innen müssen damit aufhören, die Forderungen und Haltungen der AfD nachzuahmen oder zu übernehmen. Kontroverse Aussagen von Friedrich Merz zum Stadtbild und zu Migrant:innen sowie das ständige Reden über die Migrationspolitik schwächen die AfD nicht. Stattdessen vermitteln sie den Eindruck, dass Migration tatsächlich das dominierende Problem sei. Allerdings haben die SPD und insbesondere die CDU diese Entwicklung bewusst herbeigeführt bzw. in Kauf genommen.
Demnach sollten wir unsere Hoffnungen verstärkt in die Gesellschaft und Medien setzen. Für den aufgeklärten Teil unserer Gemeinschaft wäre es vorteilhaft, mehr Verständnis zuzulassen. Das heißt nicht, dass man AfD-Wähler:innen in seinen Freundes- oder Bekanntenkreis aufnehmen soll, sondern ihnen eine zweite Chance gibt. Sofern es sich nicht um blinde oder extremistische Gefolgsleute handelt, kann es sich lohnen, mit ihnen über die Beweggründe ihrer Wahl zu sprechen. Ich habe diese Erfahrung selbst gemacht und konnte etwa Arbeitskollegen zur Abkehr oder zumindest zum Nachdenken anregen.
Die größte Verantwortung liegt aber bei den Medien und Bildungseinrichtungen. Sie dürfen nicht auf ein bloßes Framing oder Ausgrenzen der AfD setzen. Das ist ineffizient und befördert Reaktanz. Stattdessen müssen sie regelmäßig aufklären und versuchen, die inhaltlichen Defizite der AfD zu entlarven.
Ein gutes Beispiel hierfür verkörpert eine Markus Lanz-Sendung vom 25.03.2025 mit dem Titel „AfD-Politiker Kotré für Klimabehauptungen kritisiert“. Dort sitzt der energiepolitische Sprecher der AfD Steffen Kotré dem Klimaforscher Mojib Latif gegenüber und zweifelt durchgehend den menschengemachten Anteil am Klimawandel an. Dabei beruft er sich auf Einzelmeinungen von Wissenschaftlern. Latif korrigiert jedoch die Falschbehauptungen von Kotré und verweist wiederholt auf die wissenschaftliche Datenlage. Kotré vermag dem wenig entgegenzuhalten und verstrickt sich schnell in Widersprüche. Zudem stellt sich rasch heraus, dass die von ihm genannten Wissenschaftler falsch zitiert wurden und keineswegs seine Ansicht teilen. Solche Auftritte von AfD-Funktionären offenbaren schonungslos die Inkompetenz und Lügen ihrer Partei. Die Medienanstalten sollten daher öfter den Mut haben, AfD-Politiker:innen einzuladen. Nicht, um ihnen eine Bühne zu geben, sondern um sie mit Expert:innen und gut vorbereiteten Journalist:innen vorzuführen. Selbst wenn nur einige Wechselwähler:innen oder (potentielle) AfD-Sympathisant:innen dadurch zum Umdenken bewegt werden, wäre es ein Erfolg.
Die Situation wird jedenfalls immer ernster. Die Ursache hierfür liegt vor allem in dem politischen Versagen der letzten Jahrzehnte. Nun zu erwarten, die altbekannte Koalition würde daran etwas tiefgreifend ändern, wäre naiv. Vielmehr liegt es an uns, das weitere Erstarken der AfD zu verhindern. Anderenfalls sehen wir einer düsteren Zukunft entgegen.
Weiterführende Literatur:
Hafeneger, Benno (2018): Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und AfD, in: Hans Berkessel; Wolfgang Beutel; Susanne Frank; Markus Gloe; Tilman Grammes; Christian Welniak (Hrsg): Demokratie als Gesellschaftsform. Frankfurt am Main: Wochenschau Verlag, S. 145-157.
Lehmann, Pola; Matthieß, Theres (2017): „Nation und Tradition. Wie die Alternative für Deutschland nach rechts rückt“, in: WZB-Mitteilungen 156, S. 21-24.
Schaefer, Johannes (2019): Dem Volk aufs Maul geschaut? Eine Analyse des Sprachgebrauchs der AfD im Bundestagswahlkampf 2017, in: Eckhard Jesse; Tom Mannewitz; Isabel-le-Christine Panreck (Hrsg.): Populismus und Demokratie. Interdisziplinäre Perspektiven. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, S. 99-119.
Schiebel, Christoph (2019): Rechtsextremismus im neuen Bundestag – Routine oder Rander-scheinung? Eine Inhaltsanalyse der Redebeiträge der Fraktionsmitglieder der Alternative für Deutschland (AfD) zu Zeiten der Regierungsbildung, in: Eckhard Jesse; Tom Mannewitz; Isabelle-Christine Panreck (Hrsg.): Populismus und Demokratie. Interdisziplinäre Perspektiven. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, S. 121-137.