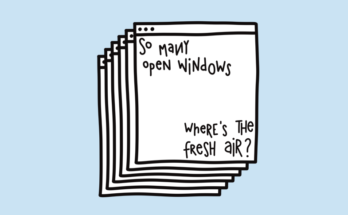von Arian Dost
Es sind nur noch zwei Tage bis zur vorgeschobenen Bundestagswahl. Für viele von uns Studis ist es auch die erste Bundestagswahl überhaupt, in der wir unsere Stimme einbringen können. Dass es eine Erst- und Zweitstimme gibt, hat jede:r sicherlich schon mal gehört, aber was der Unterschied zwischen ihnen ist, ist vielleicht auf den ersten Blick nicht klar. Zudem hat jede Person, die in Rostock lebt, bestimmt durch die Medien mitbekommen, dass Rostock als strategisch wichtiger Wahlkreis zählt. Dies hängt mit unserem Wahlrecht und der Grundmandatsklausel zusammen. Vor allem Die Linke welche mit ihrer „Mission Silberlocke“ besonders auf diese Klausel setzt, wird des Öfteren als Beispiel zur Veranschaulichung der Funktion der Grundmandatsklausel dienen. Ich weiß, dass Wahlrecht auf den ersten Blick langweilig wirken kann, jedoch wird im folgenden Abschnitt versucht, relativ einfach und interessant die wichtigsten Punkte zusammenzutragen. Im Anschluss folgt ein exklusives Interview mit Dietmar Bartsch (Die Linke), welcher zu den drei Silberlocken gehört und dem heuler Rede und Antwort zum aktuellen Wahlrecht steht, aber auch Fragen beantwortet, die besonders für uns Studis relevant sind.
Kommen wir zunächst zur Erst- und Zweitstimme. Was ist der Unterschied und wie könnt ihr damit die Zusammenstellung im Bundestag beeinflussen? Mit der Erststimme wählt ihr ein:e Kandidat:in direkt für den Wahlkreis Rostock – Landkreis Rostock II. Die Person mit den meisten Stimmen gewinnt das Direktmandat und zieht direkt in den Bundestag ein. In der Vergangenheit traten hier bekannte Politiker:innen an, darunter wie bereits erwähnt Dietmar Bartsch (Die Linke), aber auch Persönlichkeiten wie Peter Stein (CDU). Die Zweitstimme hingegen ist entscheidend für die Zusammensetzung des Bundestags, da sie bestimmt, wie viele Sitze eine Partei insgesamt erhält. Sie wird für die Landesliste einer Partei abgegeben. Wenn eine Partei mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen bundesweit oder drei Direktmandate gewinnt (Grundmandatsklausel), erhält sie entsprechend ihres Zweitstimmenanteils Sitze im Bundestag. In Rostock entscheidet die Zweitstimme also darüber, wie stark Parteien wie SPD, CDU, Grüne, AfD oder Die Linke im Bundestag vertreten sind. Durch das Zweistimmensystem kann es also passieren, dass eine Partei mit wenigen Erststimmen dennoch Abgeordnete über die Zweitstimme entsendet – oder dass ein:e Direktkandidat:in in den Bundestag kommt, obwohl die eigene Partei bundesweit schwach abschneidet. Dies war tatsächlich bei der letzten Bundestagswahl der Fall, bei Der Linken. Sie erreichte mit ihren Zweitstimmen nur 4,9 Prozent und lag somit unter der geforderten Fünf-Prozent-Hürde. Jedoch konnte sie bundesweit die geforderten drei Direktmandate (durch die Erststimmen) gewinnen. Es waren in Berlin-Treptow-Köpenick – Gregor Gysi, in Berlin-Lichtenberg – Gesine Lötzsch und in Leipzig II – Sören Pellmann.
Hätte Die Linke in der letzten Bundestagswahl nicht die drei Direktmandate erlangt, so wäre sie offiziell keine „Fraktion“, sondern raus. Dann gibt es noch im Bundestag neben den Fraktionen eine so genannte „Gruppe“. Doch was ist dabei genau der Unterschied? Wie bereits angeklungen, besteht eine Fraktion aus Abgeordneten einer Partei, die entweder mindestens 5 Prozent der Zweitstimmen erhalten oder drei Direktmandate gewonnen haben. Fraktionen haben weitreichende Rechte: Sie bekommen mehr Redezeit, können Ausschussvorsitzende stellen, haben Einfluss auf die Tagesordnung und erhalten höhere finanzielle Mittel zur Unterstützung ihrer Arbeit. Anders sieht es bei einer Gruppe aus. Parteien, die die Fünf-Prozent-Hürde nicht erreichen sind wie gesagt nicht im Bundestag vertreten. Dennoch können sich mehrere gleichgesinnte Mitglieder eines Bundestages zu einer Gruppe zusammenschließen. Dieser Fall trat bei der Abspaltung von Sahra Wagenknecht und ihrem Gefolge zur BSW-Gruppe ein. Dies bedeutet weniger Redezeit, kaum Einfluss in Ausschüssen und eine eingeschränkte parlamentarische Rolle.
Generell ist für viele Parteien dadurch die Zweitstimme von größerer Bedeutung, aber anhand der letzten Bundestagswahl lässt sich erkennen, dass vor allem für Parteien, die Probleme mit dem Erreichen der Fünf-Prozent-Hürde haben, die Erststimme von einer herausgehobenen Relevanz zeugt. Deshalb gibt es auch jedes Jahr viele Bürger:innen, die strategisch mit ihrer Erststimme wählen. Bei der Bundestagswahl können Wähler:innen ihre Erststimme strategisch einsetzen, um den Wahlausgang in ihrem Wahlkreis zu beeinflussen. Da das Direktmandat nur an die:den Kandidat:in mit den meisten Stimmen geht, wählen viele Bürger:innen taktisch, anstatt nur nach ihrer Parteipräferenz zu entscheiden. Eine gängige Strategie ist das „Kleinere-Übel“-Prinzip. Dabei geben Wähler:innen ihre Erststimme nicht an eine:n bevorzugte:n Kandidat:in, sondern der Person, die die besten Chancen hat, eine:n unerwünschte:n Bewerber:in zu schlagen. So könnte ein:e Partei A-Wähler:in in einem Wahlkreis, in dem das Rennen zwischen Partei B und Partei C entschieden wird, die eigene Stimme der:dem C-Kandidat:in geben, um einen Kandidat:in B-Sieg zu verhindern. Eine weitere Taktik ist die „Leihstimmen“-Strategie, bei der Wähler:innen ihre Erststimme einer kleineren Partei geben, um ihr ein Direktmandat zu sichern. Dies kann besonders wichtig sein, wenn diese Partei bundesweit unter der Fünf-Prozent-Hürde liegt, aber durch drei Direktmandate dennoch in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen könnte, wie zuvor erläutert. Strategisches Wählen mit der Erststimme kann also den Wahlausgang in einzelnen Wahlkreisen erheblich beeinflussen und damit indirekt auch die Zusammensetzung des Bundestages mitbestimmen.
Genau deshalb hat Die Linke die Mission „Silberlocke“ im diesjährigen Wahlkampf ins Leben gerufen. Sie hoffen, mit drei alten, erfahrenen und deutschlandweit bekannten Gesichtern die meisten Erstimmen in ihren Wahlkreisen zu erhalten. Die drei Gesichter sind in diesem Fall Bodo Ramelow: Er tritt im Wahlkreis Erfurt – Weimar – Weimarer Land II an. Gregor Gysi: Er kandidiert erneut im Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick, den er bereits in der Vergangenheit erfolgreich vertreten hat. Und Dietmar Bartsch: Er kandidiert für das Direktmandat im Wahlkreis Rostock – Landkreis Rostock II. Und hier schließt sich der Kreis wieder, weshalb Rostock in den Medien oft als strategisch wichtiger Wahlkreis gehandelt wird.
Kehren wir nochmal zurück zum zuvor erwähnten „Kleinere-Übel“-Prinzip. Das folgende Beispiel erläutert eine Besonderheit des neuen Wahlrechts. Die Prognose für die Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist klar: Die AfD wird aller Voraussicht nach nicht alle Direktmandate halten können. In MV werden voraussichtlich 14 Kandidat:innen in den Bundestag einziehen, wobei Direktmandate nur vergeben werden, wenn sie durch den Zweitstimmenanteil gedeckt sind – absteigend nach dem Erststimmenergebnis in den jeweiligen Wahlkreisen. Für die AfD bedeutet das: Selbst wenn sie sechs Wahlkreise direkt gewinnt, müsste sie dafür fast 50 % der Zweitstimmen im Land holen. Das ist äußerst unwahrscheinlich. Realistischer sind 30 % Zweitstimmen, was bedeutet, dass sie maximal vier oder fünf Direktmandate besetzen kann. Besonders in Rostock wird sich das bemerkbar machen. Laut Medien und Wahlforschungsinstituten wird Burmeister, die AfD-Kandidatin, wohl hier voraussichtlich das schwächste Erststimmen-Ergebnis ihrer Partei in MV holen, weil sie auf besonders starke Konkurrenz trifft (Stand 20.02.25 / Burmeister-26%, Zweitplatzierter Bartsch-24%). Damit ist sie raus – das neue Wahlrecht erledigt das von selbst. Das neue Wahlrecht sorgt dafür, dass das taktische Wählen in Rostock überflüssig ist. Es gibt keinen Grund, seine Stimme zu „verleihen“. Sprich jede:r sollte den/die Direktkandidat:in wählen, die einem selbst am nächsten steht. Dennoch taktieren auch hier die Politiker selbst, wie beispielsweise der Fraktionsvorsitzende der Grünen Rostock Uwe Flachsmeyer. Er rief öffentlich auf Social-Media dazu auf mit der Erststimme einen anderen Direktkandidaten zu wählen und damit nicht den Kandidaten der eigenen Partei die Erststimme zu geben. Somit ist erkennbar, dass nicht nur die Wähler:innen, dass „Kleinere-Übel“-Prinzip für sich nutzen. Sondern auch Funktionäre der einzelnen Parteien, um die eigene Wählerschaft zu Gunsten eines anderen Kandidaten zu mobilisieren.
Somit kommen wir zu den wichtigsten Änderungen des Wahlrechts. Mit der Wahlrechtsreform 2023 wurden bedeutende Änderungen am deutschen Wahlrecht vorgenommen, die vor allem die Größe des Bundestages und die Mandatsvergabe betreffen. Ein zentrales Ziel ist es, die Zahl der Abgeordneten auf 630 Sitze zu begrenzen und Verzerrungen durch das bisherige System zu verhindern. Eine der wichtigsten Neuerungen ist der Wegfall von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Bisher erhielt eine Partei Überhangmandate, wenn sie durch die Erststimme mehr Direktmandate gewann, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustanden. Diese wurden durch Ausgleichsmandate für andere Parteien kompensiert, was den Bundestag massiv vergrößerte. Mit der Reform entfallen diese Mechanismen – die Sitzverteilung basiert nun ausschließlich auf dem Zweitstimmenergebnis. Eng damit verbunden ist die Einführung des Zweitstimmendeckungsprinzips. Dieses besagt, dass nur so viele Direktkandidat:innen einer Partei in den Bundestag einziehen, wie es dem Anteil ihrer Zweitstimmen entspricht. Damit kann es vorkommen, dass ein:e Kandidat:in zwar den eigenen Wahlkreis gewinnt, aber kein Mandat erhält, wenn die eigene Partei insgesamt nicht genug Zweitstimmen bekommt. Diese Änderung könnte in Rostock wie beim AfD-Beispiel zuvor erläutert, auch hier zum Tragen kommen.
Eine besonders umstrittene Änderung betraf die Grundmandatsklausel. Ursprünglich sollte diese Regelung abgeschafft werden, wodurch Parteien, die bundesweit unter fünf Prozent der Zweitstimmen lagen, auch dann nicht in Fraktionsstärke in den Bundestag eingezogen wären, wenn sie drei Direktmandate gewonnen hätten. Doch das Bundesverfassungsgericht erklärte diese Abschaffung 2024 für verfassungswidrig, sodass die Grundmandatsklausel für die Bundestagswahl 2025 weiterhin gilt. Durch die Reform wird der Bundestag künftig nicht mehr unnötig aufgebläht und die Sitzverteilung spiegelt exakter den Wähler:innenwillen wider. Gleichzeitig bleiben zentrale Schutzmechanismen wie die Grundmandatsklausel bestehen, um die politische Vielfalt zu sichern.
Im Anschluss folgt das Exklusivinterview mit dem Direktkandidaten Dietmar Bartsch.
Das Interview wurde am 14.02.2025 geführt und war lange geplant. Auf Grund der Thematischen Nähe zur Grundmandatsklausel und der besonderen Rolle von Dietmar Bartsch und der Linken, welche besonders auf diese Strategie setzt, wurde dieser Politiker für das folgende Interview ausgewählt. In der Vergangenheit wurden beim Heuler bereits diverse andere Politiker von anderen Parteien zu verschiedenen Themen Interviewt. Die Aussagen von Dietmar Bartsch müssen nicht die der Redaktion widerspiegeln. Der Beitrag stellt keine Wahlempfehlung dar, sondern informiert über die Grundmandatsklausel. Der heuler achtet in seiner Arbeit auf Neutralität und bevorzugt keine Parteien.
Interview mit Dietmar Bartsch zur Grundmandatsklausel
ALLGEMEIN
heuler: Die Grundmandatsklausel ermöglichte Der Linken 2021 den Einzug in den Bundestag. Sehen Sie diese Regelung als faire Berücksichtigung regional starker Parteien oder als Verzerrung des Wähler:innenwillens? Sollte sie reformiert oder abgeschafft werden?
Bartsch: Die Grundmandatsklausel ist vor allem ein Mittel, die undemokratische Sperrklausel zumindest abzumildern, und ein guter Weg, um kleinere, regional stark aufgestellte Parteien fair zu behandeln und deren demokratische Mitwirkung zu ermöglichen. Solange es die Fünf-Prozent-Hürde gibt, ist die Grundmandatsklausel wichtig und sollte nicht abgeschafft werden.
heuler: Welche Parteien könnten zukünftig von der Grundmandatsklausel profitieren, und wie würde das die deutsche Parteienlandschaft verändern?
Bartsch: Bei dieser Wahl höchstwahrscheinlich keine.
heuler: Angesichts aktueller Umfragewerte: Welche Strategie verfolgt Die Linke, um wieder über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen, und welche Reformen des Wahlrechts wären aus Ihrer Sicht sinnvoll?
Bartsch: Unsere Strategie besteht vor allem in der Fokussierung auf die Themen, die die Menschen bewegen. Wir haben an mehr als 300.000 Haustüren geklopft und uns Probleme der Menschen angehört – hohe Mieten, steigende Lebensmittel- und Energiepreise, soziale Ungerechtigkeit, Bildungsmisere. Da sind wir dran mit zahlreichen politischen Konzepten. Wir bieten konkrete Hilfe an mit Sozialsprechstunden, Mieter-Infoveranstaltungen oder mit von uns programmierten Apps, mit denen man seine Heizkostenabrechnung auf Fehler überprüfen oder gegen Mietwucher vorgehen kann und sich bares Geld zurückholen kann. Die Linke redet nicht nur, sie hilft im Alltag. Das kommt an. Die Menschen strömen zu unseren Veranstaltungen. Wir erleben einen unfassbaren Mitgliederboom und sehen in den Umfragen: Der Trend geht nach oben. Ein besonderer Baustein unserer Strategie ist Social Media. Ich bin froh, dass wir in diesem Bereich so erfolgreich sind. Das war nicht immer so, aber es ist deutlich wichtiger geworden. Lange Zeit hatte die AfD dieses Feld quasi allein besetzt, nicht nur bei TikTok. Das Feld darf man ihnen nicht überlassen. Wir sind da auf einem guten Weg.
Zum Wahlrecht: Wir halten an der Forderung nach politischer Parität fest und setzen uns für eine Regelung im Wahlrecht ein, wonach 50 Prozent der Listenplätze und Mandate bei öffentlichen Wahlen auf Frauen entfallen müssen, zudem fordern wir die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre in allen demokratischen Entscheidungsprozessen auf europäischer, Bundes-, Länder- und Kommunalebene. Perspektivisch sind wir für die Abschaffung bzw. Absenkung der undemokratischen Sperrklausel.
ZU MECKLENBURG-VORPOMMERN
heuler: Die Linke gewann ihre drei Direktmandate 2021 in Berlin und Leipzig. Könnte Mecklenburg-Vorpommern in Zukunft eine ähnliche Schlüsselrolle spielen, und wie würden Sie die politische Stimmung dort beschreiben?
Bartsch: Denkbar ist, dass Mecklenburg-Vorpommern in Zukunft eine ähnliche Schlüsselrolle spielt. Ich würde mir das mit Blick auf Rostock und meinen Wahlkreis dort besonders wünschen.
heuler: Die Linke hat in Ostdeutschland traditionell eine starke Basis. Wie will sie diese sichern – auch unabhängig von Sonderregelungen wie der Grundmandatsklausel?
Bartsch: Der Osten wurde und wird mitunter noch stiefmütterlich behandelt und die Konsequenzen dieser Ungleichbehandlung führen weiterhin zu großen sozialpolitischen und wirtschaftlichen Problemen. Diese Ungerechtigkeiten zu benennen und zu bekämpfen, wird weiterhin auch unsere Mission und Aufgabe sein. Wir sind quasi die Ostexperten, weil wir viel klarer auch durch unsere Geschichte diese Probleme erkannt und benannt haben, und wissen, was sich ändern muss, welche Stellschrauben zu drehen sind. Aber ich gebe zu, in den letzten Jahren haben wir viel Vertrauen und Zuspruch bei vielen Menschen im Osten verloren, weil wir uns als Partei zu viel mit uns selbst beschäftigt haben, zu viel gestritten haben. Da ist viel verloren gegangen. Das ist zum Glück jetzt vorbei, alle in der Partei ziehen wieder an einem Strang und auch das wird ein Pfund sein, mit dem wir unsere politische Zukunft und die Basis sichern. Die Linke ist wieder da. Unabhängig davon wird es für uns perspektivisch wichtig sein, insbesondere dem rechtsextremen und gefährlichen Populismus der AfD etwas entgegenzusetzen, vor allem aufzuklären, dass deren Lösungen keine sind, dass ihre Forderungen Angst schüren, die Wirtschaft gefährden, Reiche begünstigen und Arme noch ärmer machen.
BEZUG ZU STUDIERENDEN UND JUNGEN WÄHLER:INNEN IN ROSTOCK
heuler: Viele Studierende fühlen sich von der Politik nicht ausreichend vertreten. Was bietet Die Linke konkret für junge Menschen und Studierende in Rostock – insbesondere in den Bereichen Hochschulfinanzierung, BAföG und Studiengebühren?
Bartsch: Ein BAföG für alle. Das bedeutet, dass es eltern-, alters- und herkunftsunabhängig und existenzsichernd sein muss und ein Vollzuschuss ist – also ohne Rückzahlungsanteil. Die Höhe muss regelmäßig an Lebenshaltungskosten angepasst werden und eine regionale Staffelung der Wohnkostenpauschale ist erforderlich. Auch Menschen mit Duldung oder humanitären Aufenthaltstiteln sollen Zugang erhalten. Wichtig bei unserem Konzept ist auch, dass das BAföG nicht nur Studierenden an Universitäten und Fachhochschulen zur Verfügung steht, sondern auch Studierenden in bestimmten Ausbildungsgängen wie Meister- und Fachschul-Programmen. Damit soll das BAföG für alle Menschen zugänglich gemacht werden, die eine formale Ausbildung oder Weiterbildung anstreben.
Ganz grundsätzlich gilt für uns: Die Finanzierung von Bildung muss als Gemeinschaftsaufgabe verstanden und als solche im Grundgesetz verankert werden. Grundfinanzierung statt Drittmittelabhängigkeit muss das Ziel sein, um Wissenschaftsfreiheit zu sichern und Kettenbefristungen zu vermeiden. In den Fokus gehört zudem der Aus- und Aufbau digitaler Infrastrukturen an den Hochschulen: Wir fordern daher einen Hochschul-Digitalpakt mit zusätzlichen finanziellen Mitteln durch Bund und Länder. Kerngedanke linker Hochschulpolitik ist auch, Dauerstellen für Daueraufgaben zu schaffen: Insbesondere für Postdocs, die zentrale Aufgaben in Forschung und Lehre übernehmen. Wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Mitarbeitende sollen planbare Arbeitsbedingungen erhalten. Im Bundestag forderten wir deswegen ein Programm, das zehn Jahre lang die Einrichtung von 100.000 unbefristeten Stellen fördert, um auf diesem Wege knapp der Hälfte des angestellten wissenschaftlichen Personals an den Hochschulen eine dauerhafte Perspektive zu ermöglichen. 50 Prozent dieser Stellen sollten mit Frauen besetzt werden.
heuler: Steigende Mieten und Lebenshaltungskosten belasten Studierende stark. Welche Maßnahmen plant Die Linke, um ihre finanzielle Lage zu verbessern?
Bartsch: Wie keine zweite Partei schlagen wir zahlreiche Maßnahmen vor, um die Wohn- und Mietpreissituation zu verbessern. Um nur einiges davon zu erwähnen: Wir fordern wirksame gesetzliche Instrumente, um Mieten zu deckeln oder zu senken, und wollen, dass der Staat und die Kommunen wieder als treibende Akteure des sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbaus auf den Plan treten, um die immer krassere Wohnungsnot und Mietpreisexplosion einzudämmen. Darum wollen wir ein echtes Investitionsprogramm für bezahlbares Wohnen in ganz Deutschland und sehen einen Bedarf von mindestens 20 Milliarden Euro pro Jahr. Mit Blick auf Mietpreise fordern wir einen bundesweiten Mietendeckel. Als Sofortmaßnahme müssten dabei Mieterhöhungen bundesweit für die nächsten sechs Jahre ausgeschlossen werden. Nur gemeinnützige Vermieter:innen, die bisher sehr niedrige Mieten angesetzt haben, sollen diese im Rahmen der Kostendeckung geringfügig erhöhen dürfen. Und: Es muss Schluss sein mit den Tricks der Vermieter für höhere Mieten: Staffelmieten und Indexmietverträge wollen wir verbieten und die Vermietung möblierter Wohnungen streng regulieren.
Mit Blick auf Lebenshaltungskosten: Wir wollen Grundnahrungsmittel, Hygieneprodukte sowie Bus- und Bahntickets von der Mehrwertsteuer befreien. Der Staat muss nicht an Grundbedürfnissen mitverdienen, zumal bei Menschen, die ohnehin wenig haben. Bei Strom und Heizen soll zudem der Durchschnittsverbrauch zu einem preisgünstigen Sockeltarif angeboten werden, Stromsperren wollen wir verbieten.
heuler: In Rostock gibt es anhaltende Diskussionen über eine bessere ÖPNV-Anbindung für Studierende. Welche Konzepte unterstützt Die Linke für bezahlbare und verlässliche Mobilität – etwa ein kostenloses oder stark vergünstigtes Ticket nach dem Vorbild des 49-Euro-Tickets?
Bartsch: Wir Linken wollen das 9-Euro-Ticket wieder einführen. Für Schüler, Azubis, Studierende und Senior:innen wollen wir ein sofortiges 0-Euro-Ticket. Die Mitnahme von Kindern sowie von Fahrrädern und Hunden soll dabei inklusive sein. Perspektivisch fordern wir einen kostenfreien ÖPNV in ganz Deutschland.
heuler: Klimapolitik ist für viele junge Menschen entscheidend. Welche konkreten Maßnahmen fordert Die Linke für eine nachhaltigere Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern?
Bartsch: Unser Ziel ist es, bis 2040 klimaneutral zu werden. Dafür müssen wir schneller und konsequenter auf erneuerbare Energien umsteigen. Das wird nur gelingen, wenn wir die Macht der großen Energiekonzerne reduzieren. Wir wollen verbindliche Ziele und Emissionsgrenzen und für Konzerne klare Vorschriften. Die Sektorziele beim Klimaschutz müssen wiederhergestellt werden. Damit Klimaschutz nicht soziale Ungleichheiten verschärft, fordern wir zur Entlastung bei CO₂-Preisen die Einführung eines sozialen Klimagelds, das Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen besonders unterstützt. Was die Energiewende betrifft, wollen wir keine fossilen Energien fördern. Stattdessen soll der öffentliche Sektor den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben. Es braucht eine dezentrale Strom- und Wärmeerzeugung, bei der Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und Genossenschaften eine größere Rolle spielen. Da Klimaschutz nur international gelingt, wollen wir die finanzielle Unterstützung von Ländern des Globalen Südens beim Klimaschutz und bei der Minderung von Klimaschäden erhöhen.
heuler: Wie will Die Linke junge Menschen in Rostock ermutigen, sich politisch zu engagieren – sei es bei Wahlen oder in politischen Bewegungen?
Bartsch: Wo wir es können, wollen wir konkret vor Ort zeigen, dass Politik machen wichtig ist, auch Spaß macht, sei es im direkten Kontakt am Infostand, bei Demos, bei Stadtteilinitiativen oder anderem. In Rostock gibt es da diverse Möglichkeiten.
Mit Blick auf junge Leute bin ich besonders froh, dass wir mit Heidi Reichinnek die TikTok-Queen der deutschen Politik in unseren Reihen haben, die junge Leute für Politik begeistert wie kaum eine zweite Politikerin in diesem Land.