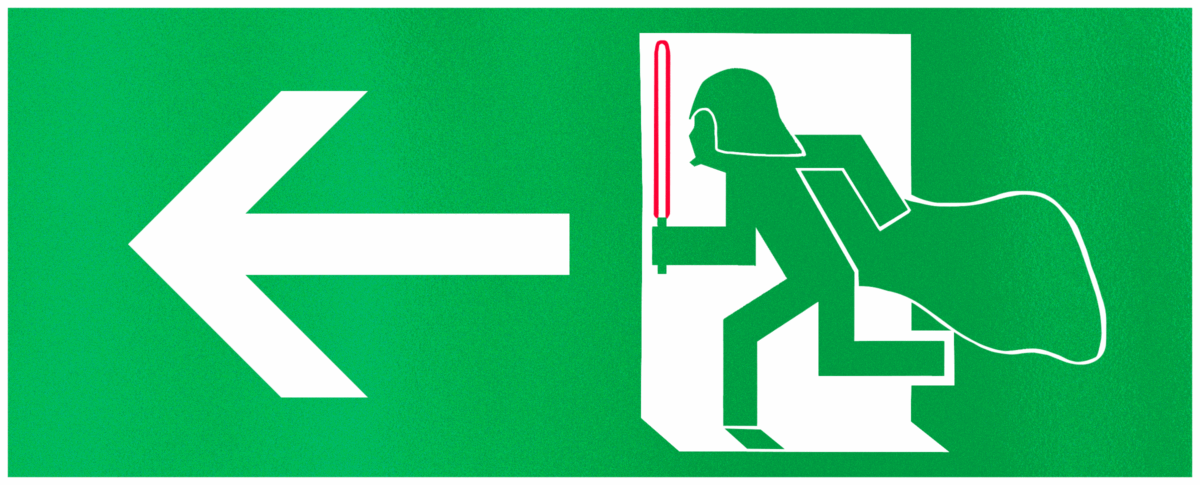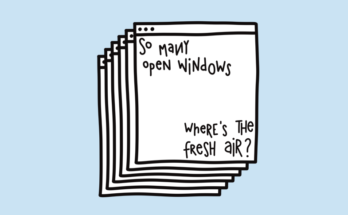Eskapismus als Bewältigungsstrategie
Ein Essay1 von Ella Rennert // Illustration von Luca Butt
Heutzutage haben Medien nicht mehr nur eine informierende Funktion, sondern werden auch zur Unterhaltung genutzt. Serien wie Bridgerton, Filme wie Star Wars oder Videospiele wie Minecraft laden dazu ein, sich in Fantasiewelten fallen zu lassen. Zwischen politischen Spannungen, Prüfungsphasen und persönlichen Problemen suchen wir in der Fiktion einen Ort der Entspannung, an dem wir uns mittels Weltenflucht ablenken lassen können.
Aber ist dieser Eskapismus in eine andere Welt nicht nur eine weitere Form der Verdrängung realer Probleme?
„It could be questioned whether escape viewing is perhaps more disfunctional than functional. The very term ‚escape‘ suggests that one does not face squarely his difficulties and is avoiding more lasting adjustment.“ (Pearlin, 1959, S. 259). Je nach Intensität des Konsumverhaltens kann die Mediennutzung krankhafte Züge annehmen (Schweiger, 2007). Der Unterhaltungsrausch gleicht einem Teufelskreis, der irgendwann nicht mehr gebrochen werden kann.
Veränderungen in den gesellschaftlichen Strukturen führen zu Unzufriedenheit im Alltag (Schweiger, 2007). Wer mit seinem Job nicht zufrieden ist, der nimmt seine Verzweiflung und Frustration mit in sein Privatleben. Um die Verzweiflung zu betäuben, schaltet man Zuhause den Fernseher ein und lenkt sich mit Radio, Filmen, Serien oder auch Büchern ab (Pearlin, 1959). Wird keine andere Bewältigungsstrategie gefunden, kann die Mediennutzung als Realitätsflucht auf Dauer verinnerlicht werden, wie es auch beim Mood-Management-Ansatz der Fall ist (Schweiger, 2007). Dieses Konzept der Medienpsychologie beschreibt, dass die Stimmung des Rezipierenden die Wahl des Mediums beeinflusst. Wer in einer Stresssituation steckt, wählt im Zuge des Ansatzes beispielsweise entspannende Musik, um aus diesem negativen Gefühl herauszukommen. Medien können also durchaus genutzt werden, um sich trotz Fluchtcharakter Linderung zu verschaffen.
Aufpassen sollte man, sobald sich daraus ein Automatismus entwickelt. Eine derartige Gewohnheit endet in hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann in einer Handlungsunfähigkeit des Rezipierenden. Wenn das geschieht, isoliert sich diese Person und kann nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Dann kann von einer Sucht gesprochen werden. Auch, wenn dies ein Extrembeispiel ist, kennt jeder das Gefühl, dem Alltag entfliehen zu wollen. In dem Falle sind Medien das Mittel der Wahl, weil fernzusehen sozial erwünschter ist, als andere Suchtmittel zu konsumieren, obwohl Drogen eine ähnlich betäubende Wirkung haben können (Katz & Foulkes, 1962).
Aber bereits Schweiger (2007) wies darauf hin, dass Eskapismus als Nutzungsmotiv in der Forschung mittlerweile als eigenständiges Motiv betrachtet wird und nicht mehr nur als Folge von sozialen Unzufriedenheiten. Demnach ist die Gesellschaftskritik hinter dem Nutzungsmotiv „Eskapismus“ veraltet. Trotzdem kann die Ansicht vertreten werden, dass es im Zeitalter der Sozialen Medien wieder zu einem ernstzunehmenden Problem geworden ist.
Die meisten von uns kennen doch das endlose Doom-Scrolling auf Plattformen wie Instagram, TikTok und co, wo Algorithmen uns davon abhalten, die App zu verlassen, auch wenn wir wissen, dass es uns nicht gut tut. Die Sozialen Medien werden immer besser darin, unsere Aufmerksamkeit für sich zu beanspruchen, also sollten wir bessere Methoden entwickeln, dagegen anzusteuern.
1Dieser Artikel ist angelehnt an eine Studienleistung der Autorin, weswegen die Zitation vom sonstigen heuler-Stil abweicht.
Quellen
Katz, E. & Foulkes, D. (1962). On the Use of the Mass Media as „Escape“. Clarification of a Concept. Public Opinion Quarterly. 26, 3, 377-388. https://doi.org/10.1086/267111
Pearlin, L. (1959). Social and Personal Stress and Escape Television Viewing. Public Opinion Quarterly. 23, 2, 255-259. https://doi.org/10.1086/266870
Schweiger, W. (2007). Theorien der Mediennutzung. Eine Einführung. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90408-5