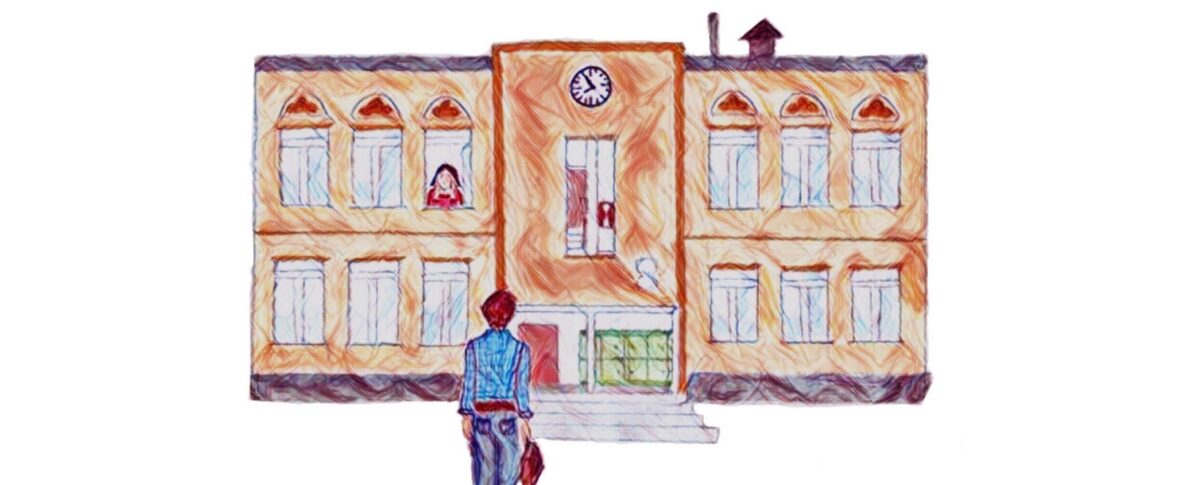Gedanken eines Lehramtsstudenten
aus dem Archiv: Heft Nr. 128
von Dennis Bossow. Illustration Rosa Staiger
Anmerkung der Redaktion: Bei Artikeln aus dem Archiv handelt es sich um Texte, die bereits vorher schon einmal in einem unserer Hefte erschienen sind. Da wir diese nicht abändern dürfen, kann es sein, dass in diesen Texten teilweise nicht korrekt gegendert wurde oder Formulierungen gewählt wurden, die wir aktuell nicht mehr verwenden würden. Im heutigen Artikel wird primär das generisches Femininum genutzt. Dies ist das Gegenteil vom verbreiterten generischen Maskulinum. Das generische Femininum beschreibt Personen mit unbekanntem oder irrelevantem Geschlecht als feminine Nomen.
Während des Semesters bot uns unsere Dozentin an, ein Praktikum an einer Schule zu absolvieren. In zwei Projektwochen zu den Themen „Lernen“ und „Gase“ sollten wir unsere ersten Lehrerfahrungen sammeln. Zu Beginn klang es relaxed und ich freute mich sehr auf die Arbeit mit den Fünftklässlern, doch am Morgen davor kamen erste Sorgen in mir auf.
Der Wecker klingelte. Ich schaute auf mein Handy und dachte mir: „5:30 Uhr – was für eine unmenschliche Zeit.“ Daraufhin drehte ich mich noch einmal um, bis mich ein Gedankenblitz traf: „Heute geht‘s in die Schule!“ Mit einem Mal stand ich unter Strom, sprang schleunigst aus dem Bett und begab mich unter die Dusche. Dort kamen die ersten Fragen auf: „Wie werde ich mich vorstellen? Werde ich mich als freundlicher, lockerer Student geben oder mir erst einmal mit einer gewissen Strenge Respekt verschaffen?“ Ich überlegte und kam zu keinem Ergebnis. Ich wusste nicht, wer ich sein wollte. Angst ergriff mich und redete eindringlich auf mich ein: „Wenn du selbst nicht weißt, wie du dich geben sollst, werden die Schülerinnen dich nicht ernst nehmen!“ Beim Blick auf die Uhr erschrak ich heftig. Es war bereits 6:30 Uhr und ich war bisher nicht angezogen und hatte nichts gegessen. Nach Essen war mir allerdings ohnehin nicht zumute, denn eine leichte Übelkeit hatte sich in meiner Bauchregion breitgemacht. Während ich mich dazu zwang, wenigstens eine Banane zu essen und einen Kaffee zu trinken, hatte ich mit der Müdigkeit zu kämpfen und verlor jegliches Zeitgefühl. Deshalb schaute ich panisch alle 30 Sekunden auf mein Handy. Mir gingen die Worte einer Dozentin durch den Kopf: „Glaubt mir, es gibt keine perfekte Klasse. Heutzutage haben fast alle ein Attest.“ Ich stellte mir einen Haufen lernschwacher, aufmerksamkeitseingeschränkter, verhaltensauffälliger und rebellischer Schüler und Schülerinnen vor. Bei diesem Gedanken entschied ich mich, der strenge Lehrer zu sein, obwohl ich mir zu Beginn meines Studiums vorgenommen hatte, dass ich nicht so werden will wie viele meiner eigenen Lehrer. „Noch kannst du zu Hause bleiben!“ Ein Angebot meines Gehirns, welches ich dann aber doch ausschlug. In der Gewissheit, dass ich nicht komplett alleine vor der Klasse stehen würde, packte ich meinen Thermobecher. Ich war entschlossen, mich der Herausforderung zu stellen und meine Ängste zu überwinden. Der Weg zur Bahn fiel mir jedoch schwerer als gedacht, denn meine quälenden Gedanken ließen mich noch immer nicht in Ruhe. „Werden die Schülerinnen mich akzeptieren? Wie wird es sein, vor über 20 fremden Augenpaaren zu stehen? Ich darf mich bloß nicht versprechen!“ Selbst die Musik, die mich aus meinen Kopfhörern bedudelte, konnte meine wachsende Aufregung nicht dämpfen.
Nach und nach stiegen Kinder und Jugendliche in die Bahn. Ich stellte meine Musik etwas leiser, um sie zu belauschen. Mein Gehirn begann, auf Hochtouren zu laufen. „Die sehen gar nicht so aus wie Hipster! Ist der Trend schon vorbei? War ich damals auch so ungehobelt? Sind das Schülerinnen aus meiner Klasse? Ich hoffe nicht! Später als Lehrer werde ich nie die gleiche Bahn nehmen wie die Schülerinnen!“ Schließlich erreichte die Bahn die Station nahe der Schule. Ich stieg aus und folgte den Schülerinnen mit etwas Abstand. Einige hielten wenige Meter vor der Schule an und begannen zu rauchen. Mir schoss die Idee durch den Kopf, ihnen die Kippen wegzunehmen. Doch ich traute mich nicht und ging mit strafendem Blick an ihnen vorbei. Wenig später stand ich vor dem Klassenraum. Ich nahm kaum wahr, wie die Kinder lärmend über den Flur und in ihre Klassenzimmer liefen. Ich war wie gelähmt. Ich spielte mit dem Gedanken, einfach umzudrehen und zu gehen. Die Tür vor meiner Nase war das Einzige, was mich noch vor den über 20 Schülerinnen schützte. Ich betrachtete die Tür genauer. Daran war eine Collage angebracht, auf der die Schülerinnen mit ihrer Lehrerin zu sehen waren. Mittendrin bildeten Zeitungsschnipsel den Satz: „Wir sitzen alle im gleichen Boot.“ Von dieser alltäglichen Phrase berührt und in der Hoffnung, dass die Lehrerin bereits im Raum war, beschloss ich, reinzugehen. Zögerlich öffnete ich die Tür und wurde so freundlich von der Lehrerin empfangen, dass jegliche Angst für den Moment verflog. An meinem ersten Tag war ich in erster Linie Beobachter und griff höchstens als Helfer bei Gruppenarbeiten aktiv ins Geschehen ein. Doch dieses Fünkchen Kontakt zu den Schülerinnen genügte bereits, um meine gesamten Ängste wie Treibholz nach und nach aufs Meer hinauszuspülen. Auf dem Weg nach Hause strahlte ich bis über beide Ohren und war stolz auf mich, aber auch fasziniert von den Schülerinnen und der intensiven Bindung der Lehrerin zu ihnen. Am zweiten Tag konnte ich den Schulbeginn kaum erwarten, in mir brodelte die Vorfreude – bis die Lehrerin mir eröffnete, dass ich nun selbst aktiv werden sollte. Mein Herz fing an zu rasen und kalter Schweiß lief mir den Nacken runter. Die Angst war zurück. Doch die Erinnerung an meinen guten Start machte mir Mut, und so entschied ich mich eine ganze Menge zu übernehmen. Da stand ich nun vor der Klasse. Noch waren alle laut am Reden, doch das sollte sich gleich ändern. „Guten Morgen! Eure Aufmerksamkeit zu mir. Edgar, dreh dich bitte auch nach vorn!“ Schnell wandten sich alle Blicke zu mir. So begann ich meine Lehrertätigkeit wirklich als strenger Mann. Doch bei den Schülerinnen kam das sehr gut an und sie nahmen mich so an, wie ich bin. Als ich merkte, dass ich von ihnen akzeptiert wurde, begann in mir eine Flamme der Leidenschaft zu brennen. Meine Sorgen darüber, wie ich bin und wie ich handele, sowie meine Angst vor den Schülerinnen, waren völlig unberechtigt. Ich musste mich nicht verstellen, sondern konnte mich einfach so geben, wie ich bin. Meine wichtigsten Werkzeuge im Umgang mit den Schülerinnen waren Authentizität und konsequentes Handeln. In der ersten Woche beschäftigten wir uns mit dem Thema „Lernen“. Durch unterschiedliche Arbeitsformen lernte ich die Kinder in verschiedenen Situationen kennen und konnte viel im Umgang mit den Schülerinnen mitnehmen. Außerdem lernte ich mich durch mein intuitives Handeln selbst als Lehrkraft kennen. Am wertvollsten war für mich aber das direkte Feedback der Kinder und der Lehrerin. Das Wissen, das ich dadurch aus meinen Praktikumserfahrungen mitnehmen konnte, hat mir bisher kein Lehrbuch oder Seminar vermitteln können. Mein Fazit nach den ersten Wochen lautete: Endlich lernte ich etwas Nützliches!
In der zweiten Woche widmeten wir uns einem „NaWi-Projekt“, in dem es um Gase ging. Jeden Tag betreute ich eine neue fünfköpfige Schülerinnengruppe aus der fünften Klasse und lernte somit viele verschiedene Kinder und ihr Verhalten kennen. Dabei trainierte ich unterschiedliche Arten, ein und denselben Sachverhalt zu vermitteln. Ich selbst wurde durch den Wissensdurst der Kleinen motiviert und sie zauberten mir, auch wenn sie mal unkonzentriert wurden, ein Lächeln ins Gesicht. Da flüsterten mir meine Gedanken ins Ohr: „Du hast das richtige Studium gewählt.“ Die Zeit an der Schule überflutete mich mit Begeisterung und Motivation. Zum Leidwesen vieler meiner Freunde, gab es für mich wochenlang kein anderes Thema mehr. Doch nun weiß ich, dass ich Lehrer werden möchte und bin motiviert weiter zu studieren. Solche Erfahrungen wünsche ich jedem Lehramtsstudentin und empfehle daher allen, auch wenn es mehr Aufwand ist, unbedingt solche praktischen Erfahrungen zu machen.
*Name wurde verändert