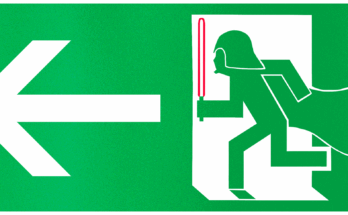Von Hannah Miltzow
Auch in diesem Dezember fanden in der Frieda 23 die Tage des indigenen Films statt. Bereits das zehnte Jahr in Folge konnten sich Interessierte im Rahmen des Projekts von Elements e.V. ein Wochenende lang eine vielfältige Mischung aus Filmen ansehen und an Workshops teilnehmen. Das diesjährige Thema „Indigene und Urbanität“ hatte das Ziel, auf die Lebensrealitäten indigener Menschen in der Stadt aufmerksam zu machen und eine Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Stadtlebens auf kulturelle Identitäten zu ermöglichen. Um dies zu bewerkstelligen, nahm das dreiköpfige Filmauswahlteam die Besucher:innen in acht Filmen von Finnland, Frankreich und Kanada über Uruguay, Bolivien, Indien, Vietnam und Mauretanien bis nach Burkina Faso mit. Obwohl Urbanität beim Jahresthema ein entscheidender Punkt war, spielten die Filme nicht nur in städtischen Gebieten, sondern zeigten auch, inwiefern Städte eine Rolle als Bezugspunkt für im ländlichen Raum lebende Indigene spielen. Dies brachte die Wechselwirkung zwischen städtischer und ländlicher Kultur zum Ausdruck.
Um die Tage des indigenen Films in Rostock zu besuchen, bedurfte es keinerlei Vorwissen, lediglich Interesse und Kenntnis der englischen Sprache. Zwar bemüht sich die Redaktion, die Filme mit deutschen Untertiteln zu beschaffen, aber oft sind nur englische verfügbar. In der Vorbereitungsphase suchten die Mitglieder des Filmauswahlteams separat in Form einer Internetrecherche nach zum Jahresthema passenden Filmen. Gemeinsam wurden diese dann angefragt und gesichtet, bevor die Aufnahme ins Programm erfolgte. Dieses Jahr kam auf diese Art eine Auswahl von sechs aktuellen Filmen der vorherigen zwei Jahre und zwei weiteren von 2016 und sogar 1987 zustande. Aber selbst die älteren Filme waren weiterhin zeitgemäß, entweder, weil die Problematik nach wie vor die selbe ist oder um aufzuzeigen, wie die Situation früher war und was sich seitdem verändert hat.
Jeder der drei Tage begann mit einem Workshop. Diese gestalteten sich äußerst abwechslungsreich und boten die Möglichkeit, direkt mit indigenen Menschen zu sprechen oder etwas über unsere eigene Vergangenheit als Kolonialmacht zu erfahren. So erklärte beispielsweise die in Berlin lebende Aktivistin und Mapuche (indigenes Volk in Chile und Argentinien) Llanquiray Painemal, wie deutsche Siedler zu der Unterdrückung der Mapuche in den beiden spanischen Kolonien beitrugen. Sie ging nicht nur auf die Geschichte des Mapuche Volks in Chile ein, sondern erläuterte die bis heute nicht überwundenen Folgen des Kolonialismus in dem Land und wie die Lebensrealität indigener Menschen in chilenischen Städten aussieht. Painemal versucht durch das von ihr gegründete Kollektiv Mawvn, andere Menschen für die Missstände, mit denen die Mapuche konfrontiert sind, zu sensibilisieren, unterstützt dabei aber auch andere indigene Völker, setzt sich für Flüchtende und gegen Rassismus ein. Mapuche heißt übersetzt übrigens „Menschen der Erde“ und sie verfolgen einen respektvollen Umgang mit der Natur, sowie zwischen Menschen und Tieren. Dennoch sind vor allem in Nordamerika viele Indigene mit der Kohleförderung und ihren Folgen konfrontiert und verlieren teilweise sogar ihr Leben, um die Biodiversität zu schützen. Dennoch hat Llanquiray Painemal Hoffnung und glaubt, dass sich gerade eine neue Generation herausbildet, die etwas ändern wird. Ihrer Meinung nach ist es wichtig, sich bewusst zu sein, wie Menschen im globalen Süden unter den Folgen unseres Konsums leiden, unter anderem weil europäische Firmen ihre Territorien zerstören, und sich Gedanken um Ressourcen und deren Beschaffung zu machen.
Beim Workshop am Samstag „Movements and Moments: Indigene Feminismen“ konnten die Teilnehmenden nicht nur etwas über die Aktivistin Dolores Cacuango, sondern auch über das Erstellen eines Comics lernen. Zu Beginn stellte eine der Herausgeber:innen, Sonja Eismann, das Comic-Projekt „Movements and Moments“ des indonesischen Goethe-Instituts vor. Dabei handelt es sich um eine Comicreihe mit 16 Geschichten, welche das Leben von Aktivist:innen aus 14 Ländern des globalen Südens beleuchten. Zehn der Geschichten erschienen in einem Comicband, die restlichen sechs wurden online veröffentlicht. Gearbeitet wurde in Teams von zwei bis drei Personen. Davon war eins, bestehend aus den Künstler:innen Citlalli Andrango Cadena und Cecilia Larrea, online in die Frieda 23 zugeschaltet, um über den Schaffungsprozess ihres Comics „Mama Dulu“ zu sprechen. Sie erläuterten ihren Rechercheprozess, den eigenen Wunsch, das Leben ihrer Protagonistin historisch korrekt zu repräsentieren, wie das Skript zustande kommt und letzten Endes auf dessen Grundlagen Skizzen und fertige Comicseiten entstehen. Danach hatten die Referent:innen noch eine Aufgabe fürs Publikum mitgebracht: Uns wurden Skripte für zwei Seiten ihres Comics gezeigt, Stifte und Blätter verteilt und wir sollten uns selbst daran versuchen, die Skripte grafisch zu realisieren. Es ging nicht um Ästhetik, sondern darum, aufzuzeigen, wie komplex es ist, historische Ereignisse ansprechend aber gleichzeitig korrekt in einen Comic zu übertragen.
Der dritte und letzte Workshop bot die Gelegenheit, sich mit der Kolonialgeschichte Rostocks in Form eines zweieinhalbstündigen Stadtrundgangs zu befassen. Dieser wurde von Soziale Bildung e.V. zusammen mit der Initiative Rostock Postkolonial organisiert. Ziel des Rundganges, der auch jederzeit virtuell über die Seite https://postkolonial.soziale-bildung.org selbst durchgeführt werden kann, war es, Bewusstsein für verschiedene Perspektiven zu schaffen und die Verbindungen der eigenen kolonialen Vergangenheit mit der Gegenwart unter Veranschaulichungen globaler Zusammenhänge hervorzuheben.
Vor jeder Filmvorführung fand durch ein Mitglied der Redaktion eine thematische Einführung statt, der das jeweilige indigene Volk vorgestellt und Informationen zu den Regisseur:innen genannt wurden. Nach den Vorstellungen gab es, nachdem dem Publikum die jüngsten Entwicklungen seit dem Erscheinen der Filme geschildert wurden, die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Filme untereinander zu diskutieren.
Der erste Film am Freitag „EATNAMEAMET – Our Silent Struggle“ war eine Dokumentation, die den Zuschauer:innen die Sámi, das letzte indigene Volk Europas, zeigte und wie sie für den Erhalt ihrer Kultur und gegen Unterdrückung durch die finnische Regierung kämpfen. Die von der Regisseurin Suvi West dargestellte Geschichte der Sámi ist beispielhaft für indigene Völker weltweit. Sie mussten und müssen immer noch kultureller Aneignung, dem Verlust des Territoriums und von Rechten, Umsiedlung, Vorurteilen, Diskriminierung und Zwangsassimilation entgegenstehen. Die Dokumentation war in Finnland ein großer Hit, da vielen Finnen nicht bewusst war, dass es in ihrem Land eine (ethnische) Minderheit gibt, die unterdrückt wird und schuf ein Bewusstsein für den schlechten Umgang, den die finnische Regierung gegenüber den Sámi pflegt. Diese leben übrigens nicht nur in Finnland, da ihr Land Sámi sich ebenfalls über Norwegen, Schweden und Russland erstreckt.
Auf Suvi Wests Doku folgte der uruguayische Spielfilm „The Employer and the Employee“ des Regisseurs Manuel Nieto Zas. Dieser erzählt die Geschichte zweier Männer aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten im Grenzgebiet zwischen Uruguay und Brasilien. Obwohl Rodrigo, der Sohn eines Großgrundbesitzers, den unerfahrenen Carlos einstellt und somit sein Vorgesetzter ist, entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden jungen Familienvätern. Doch schon bald trübt ein tragischer Unfall ihre Beziehung. Der Regisseur setzt in dem Drama stilvoll die Weite des ländlichen Uruguays in Szene und beweist bei ruhigen Tempo ein Händchen für emotionale Nuancen.
Den Abschluss des ersten Tags bildete „El Gran Movimiento“ von Kiro Russo. In diesem auf 16 mm-Film gedrehten Werk wurden dokumentarische Elemente mit dem Phantastischen verbunden, was zu einer mysteriösen und düsteren Atmosphäre mit großer Bildgewalt beiträgt. Im Zentrum steht die bolivianische Hauptstadt La Paz, der die Zuschauer:innen im Verlauf des Films während der Reise von Minenarbeiter Elder und seinen Freunden immer näher kommen.
Der Samstag begann mit zwei Filmen aus Kanada. Zuerst ging es in den Norden und zwar in das größte Inuit-Territorium Nunavut. Alethea Arnaquq-Barils Dokumentation „Angry Inuk“ erschien zwar 2016, aber ihr Inhalt startet bereits 2008 und behandelt einen Zeitraum von sechs Jahren. Die Regisseurin, selbst Inuit, stellt erst die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung der Robbenjagd dar, bevor auf die Auswirkungen von „anti-sealing“-Kampagnen verschiedener Tierschutzorganisationen eingegangen wird. Diese behaupten, es sei unmoralisch, Robben für ihr Fell zu töten und gehen gegen kommerzielle Robbenjagd vor, unterstützt von hochkarätigen Stars wie Paul McCartney. Oft werden für die Kampagnen Fotos von den niedlichen Sattelrobben-Jungtieren benutzt, während Informationen verschleiert oder durch Fehlinformationen ein falscher Eindruck erzeugt wird. Tatsächlich ist es so, dass der Großteil kommerzieller Robbenjagd und der Verkauf von Fellen durch Inuit selbst geschieht und diese das komplette Tier verwerten, indem sie das Fleisch essen. Des Weiteren hilft ihnen die Kleidung aus Robbenfellen, in dem harten Lebensraum zurechtzukommen. Sattelrobben werden gar nicht bejagt und die durch Inuit bejagten Robben sind keine bedrohte Art, sondern verzeichneten sogar steigende Populationen. Dennoch sorgten die Kampagnen von Organisationen wie Greenpeace dafür, dass der Markt zusammenbrach und die EU 2009 sogar die kommerzielle Robbenjagd verbot, sodass viele Inuit ihre Lebensgrundlage verloren und gezwungen sind, in Armut zu leben. Daher begleitete Alethea Arnaquq-Baril im Verlauf ihrer Dokumentation über mehrere Jahre hinweg verschiedene Inuit-Aktivist:innen im Kampf um Aufklärung, Richtigstellung und dem Erhalt der eigenen kulturellen Traditionen, während sie auch selbst versuchte unter dem Motto „It‘s time for a new model of animal activism“, etwas zu verändern.
Mit dem nächsten Film „BEANS“ verblieben wir in Kanada, aber betrachteten die nahe Montréal lebenden Mohawks während der Oka-Krise im Sommer 1990. Die Regisseurin Tracey Deer war selbst als junges Mädchen dabei und arbeitet in dem Drama ihre eigenen Erlebnisse auf, während sie darstellt, wie gewalttätige Proteste dieser Art junge Menschen traumatisieren. Der Film zeigt in einer Mischung aus gedrehten Szenen und Archivmaterial, wie es sich anfühlt, Opfer von großem Hass zu sein, aber bleibt durch die subtile Darstellungsweise einem jüngeren Publikum zugänglich.
Der zweite Tag fand ein Ende mit einem indischen Film von Payal Kapadia. „A Night of Knowing Nothing“ ist ebenfalls ein Essay-Film, der Dokumentarisches mit Fiktivemverbindet und der Regisseurin2021 den Dokumentarfilmpreis bei den Filmfestspielen in Cannes einbrachte. Erzählt wird die Geschichte einer an der staatlichen Filmhochschule von Mumbai eingeschrieben jungen Stundentin (L.), die ihrem Liebhaber aus einer anderen Kaste (K.) Briefe schreibt und von dem politischen Wandel im Land berichtet. In diesem Rahmen geht der Film auch auf die Demonstrationen, Streiks und Proteste als Reaktionen auf die durch die BJP Partei gebrachten Veränderungen ein.
Am Sonntag gab es einen Film weniger zu sehen. Den Anfang machte die Dokumentation „Children of the Mist“ von Ha Le Diem. Die vietnamesische Filmemacherin bekam in ihrer eigenen Jugend mit, wie einige ihrer Freundinnen sehr früh verheiratet wurden. Deswegen war es ihr ein Anliegen, einen Film über die Schönheit der Kindheit, aber auch deren Vergänglichkeit, zu drehen. Dafür reiste sie alleine mit einer kleinen Kamera und ohne die Sprache zu sprechen, zu den Hmong, einem vietnamesischen Volk, das fast schon eine Einsiedler-Existenz führt, und lebte dort innerhalb von drei Jahren immer wieder bei der Familie der jungen Di. Die Regisseurin selbst sagt über sich und Di „we became friends, sisters even“. Daher fiel es ihr auch zunehmend schwerer, den Abstand einer Dokumentarfilmerin zu wahren, bis ihre Gefühle sie letztlich sogar übermannten und sie versuchte, in das Geschehen einzugreifen. Die Hmong haben den kulturellen Brauch des Brautraubs. Dabei werden während des Lunar New Year Mädchen als Bräute entführt. Gefällt einem der Mann nicht, versucht man wegzurennen, aber die letzte Entscheidung bleibt bei den Kindern, so kann nach einem Brautraub im gegenseitigen Einverständnis ein Trennungswein getrunken werden, was die Verlobung auflöst. Allerdings gestaltete sich dies im Film für die junge Di als sehr schwierig, da sowohl ihre eigene Familie, als auch die Familie des Jungen, der sie entführt hat, versuchen, die beiden zu der Hochzeit zu nötigen. Dabei ist eine Heirat zwischen Minderjährigen in Vietnam illegal. In diesem und weiteren Momenten zeigt die Doku den Konflikt zwischen kultureller Tradition und Selbstbestimmung.
Die Tage des indigenen Films endeten mit dem auf einem Roman basierenden Historienfilm „Sarraounia“ von Med Hondo. Diese Geschichte über die Herrscherin und Oberhaupt der in Lougou lebenden Azna, die sich bei der Verteidigung ihres Volkes kolonialen Großmachtfantasien entgegenstellt und dabei zum Symbol des Widerstand wird, gilt als ein Klassiker des Antikolonialen Films.
Besucht man die Tage des indigenen Films steht eine Sache definitiv fest: Man wird sehr viel lernen. Das Programm ist vielfältig aufgebaut und breit gefächert. Es steht nicht ausschließlich die indigene Identität im Vordergrund, sondern es werden auch andere Problematiken wie soziale Ungleichheit und Armut beleuchtet. Außerdem sind sie eine Möglichkeit, andere Lebensrealitäten kennenzulernen. Somit stellen die Tage des indigenen Films eine fantastische Möglichkeit dar, den eigenen Horizont zu erweitern.
Quellen:
https://indigenerfilm.de/ [Zugriff am 18.12.2022]
https://www.goethe.de/ins/id/de/kul/kue/mmo.html[Zugriff am 18.12.2022]