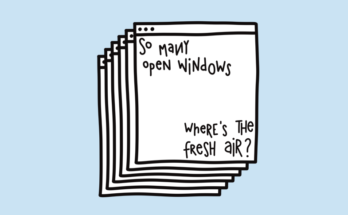von Joanna Fackendahl // Illustration von Lara Kaminski
Die Geschichte der Wissenschaft und Kultur wird häufig als eine Abfolge genialer Männer erzählt. Namen wie Bertolt Brecht, Otto Hahn oder James Watson sind fester Bestandteil unseres kollektiven Gedächtnisses. Doch allzu oft gerät dabei aus dem Blick, dass Frauen maßgebliche Beiträge geleistet haben – Beiträge, die ihnen aber nicht zugeschrieben wurden. Ideen, Forschungsresultate, literarische Vorarbeiten: all das fand Eingang in große Werke oder bahnbrechende Entdeckungen, ohne dass die eigentlichen Urheberinnen genannt wurden.
Die Journalistin Leonie Schöler beschreibt in ihrem Buch Beklaute Frauen zahlreiche dieser Fälle und macht deutlich, dass es sich keineswegs um Einzelfälle handelt, sondern um ein strukturelles Muster, das sich durch Jahrhunderte zieht. Auch der sogenannte Matilda-Effekt, ein Begriff aus der Wissenschaftsgeschichte, benennt genau dieses Phänomen: Frauen werden in der Forschung unsichtbar, während ihre männlichen Kollegen die Anerkennung einstreichen.
Frauen, die „mitgeschrieben“ haben und doch verschwanden
Ein besonders drastisches Beispiel stammt aus der Literaturgeschichte. Elisabeth Hauptmann war seit Mitte der 1920er Jahre eng mit Bertolt Brecht verbunden. Sie übersetzte, skizzierte, formulierte und war maßgeblich an der Dreigroschenoper beteiligt. Heute gilt Brecht als alleiniger Autor des Welterfolgs, während Hauptmanns Anteil jahrzehntelang verschwiegen wurde. Erst die neuere Forschung konnte zeigen, dass ihre Arbeit die Grundlage des Stücks war. Dennoch blieb sie in der Öffentlichkeit lange Zeit bloß „Brecht-Assistentin“.
Ganz ähnlich verhielt es sich in der Wissenschaft. Rosalind Franklin lieferte mit ihren Röntgenaufnahmen der DNA den entscheidenden Beweis für die Doppelhelix-Struktur. Watson, Crick und Wilkins erhielten dafür 1962 den Nobelpreis und Franklin wurde nicht einmal erwähnt. Ihre Ergebnisse waren von den Kollegen ohne ihr Wissen weitergereicht worden. Erst in den letzten Jahrzehnten wurde die Tragweite ihrer Leistung nachträglich gewürdigt.
Auch die Physikerin Lise Meitner erlebte, wie ihre Arbeit unsichtbar gemacht wurde. Gemeinsam mit Otto Hahn trieb sie die Erforschung der Kernspaltung voran. Doch als 1945 der Nobelpreis für Chemie verliehen wurde, ging er ausschließlich an Hahn. Meitner, die als Frau und Jüdin ohnehin mit doppelten Barrieren konfrontiert war, wurde übergangen. Heute trägt ein chemisches Element (Meitnerium) ihren Namen, eine späte Form der Anerkennung, die ihr zu Lebzeiten versagt blieb.
Ein besonders tragisches Schicksal ist mit Clara Immerwahr verbunden, der ersten promovierten Chemikerin Deutschlands. Trotz ihrer Qualifikation durfte sie lediglich unbezahlte Assistenzstellen bekleiden. Nach der Heirat mit Fritz Haber, dem „Vater“ der deutschen Chemieindustrie, wurde ihr signalisiert, dass ihre eigentliche Aufgabe nun im Haushalt liege. Ihre wissenschaftliche Arbeit musste sie aufgeben und als Haber schließlich die Entwicklung von Giftgas vorantrieb, lehnte sie dies aus moralischen Gründen ab. Ihr Leben endete tragisch und bis heute steht ihr Name für die zerstörerische Macht patriarchaler Strukturen.
Strukturen, die Frauen unsichtbar machten
Diese Beispiele lassen erkennen, dass es sich nicht um individuelle Tragödien, sondern um ein Muster handelt. Wissenschaft und Kultur waren über Jahrhunderte patriarchal organisiert. Universitäten, Verlage und Preisverleihungen waren Männerdomänen. Frauen konnten, wenn überhaupt, in Nebenrollen wirken als „Assistentinnen“, „Helferinnen“ oder „Muse“. Hinzu kamen gesellschaftliche Rollenbilder, die Frauen auf Haushalt und Familie festlegten. Selbst hochgebildete Forscherinnen mussten ihre Karriere abbrechen, sobald sie heirateten oder Kinder bekamen. Der Matilda-Effekt wirkt hier wie ein Brennglas: Er zeigt, dass die strukturelle Unsichtbarkeit kein Zufall war, sondern ein systematisches Ergebnis gesellschaftlicher Machtverhältnisse.
Auch die Form, in der Geschichte erzählt wurde, verstärkte den Effekt. Die sogenannte „Great-Man“-Erzählweise, nach der große Männer mit bahnbrechenden Ideen den Lauf der Welt bestimmten, ließ kaum Raum für weibliche Mitstreiterinnen. Wo doch Frauen beteiligt waren, verschwanden sie in Fußnoten oder in Anmerkungen – wenn überhaupt.
Von der Vergangenheit in die Gegenwart
Man könnte meinen, all das sei heute Geschichte. Doch aktuelle Untersuchungen zeigen, dass auch in der Gegenwart wissenschaftliche Leistungen von Frauen seltener zitiert und weniger beachtet werden als die ihrer männlichen Kollegen. Noch immer besteht ein „Gender Citation Gap“, eine Kluft in der Sichtbarkeit. Frauen sind in Leitungspositionen an Hochschulen unterrepräsentiert und auch große Preise und Stipendien gehen häufiger an Männer.
Gleichzeitig wächst jedoch das Bewusstsein für diese Ungleichheiten. Werke wie Schölers Beklaute Frauen oder neue Studien über den Matilda-Effekt tragen dazu bei, die Geschichten vergessener Forscherinnen und Künstlerinnen ans Licht zu holen. Archive werden neu durchforstet, Biografien neu geschrieben, und nicht wenige Institutionen versuchen inzwischen, Preisvergaben und Berufungsverfahren gerechter zu gestalten.
Warum wir diese Geschichten brauchen
Die Anerkennung weiblicher Leistungen ist nicht nur eine Frage historischer Gerechtigkeit. Sie ist auch entscheidend für unsere Gegenwart. Wenn die Erfolge von Frauen sichtbar gemacht werden, gewinnen junge Studentinnen und Wissenschaftlerinnen Vorbilder, an denen sie sich orientieren können. Gleichzeitig lernen auch alle, dass Exzellenz und Innovation nicht geschlechtsgebunden sind.
Darüber hinaus ist es eine Frage wissenschaftlicher Wahrhaftigkeit. Wenn wir verstehen wollen, wie große Erkenntnisse entstanden sind, müssen wir die ganze Geschichte erzählen und nicht nur die halbe. Denn jede verschleierte Biografie, jede unterschlagene Leistung ist auch ein Verlust für unser kollektives Wissen.
Die Geschichten von Elisabeth Hauptmann, Rosalind Franklin, Lise Meitner oder Clara Immerwahr zeigen auf schmerzliche Weise, wie Frauen in Wissenschaft und Kultur systematisch übergangen wurden. Sie sind Beispiele für eine größere Struktur: die Unsichtbarmachung weiblicher Leistungen. Auch wenn heute vieles besser geworden ist, bleibt die Aufgabe, diese Mechanismen weiter aufzudecken und die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass niemand, egal welches Geschlechtes, „beklaut“ wird und das weder um Ideen noch um Anerkennung noch um eine Stimme.